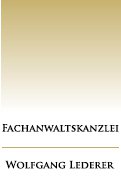-
 Effektive Methoden & innovative rechtliche LösungenErfolg ist unser Anspruch
Effektive Methoden & innovative rechtliche LösungenErfolg ist unser Anspruch -
 Wir bleiben zielstrebig,von Fall zu FallWir betrachten jeden Fall ganz individuell und setzen unsengagiert und mit professionellem Fingerspitzengefühl fürunsere Mandanten ein. Denn jeder Klient wird von unshoch geschätzt und jede Angelegenheit gewürdigt.
Wir bleiben zielstrebig,von Fall zu FallWir betrachten jeden Fall ganz individuell und setzen unsengagiert und mit professionellem Fingerspitzengefühl fürunsere Mandanten ein. Denn jeder Klient wird von unshoch geschätzt und jede Angelegenheit gewürdigt. -
 Nachhaltige EntschlossenheitUnsere Strategie ist speziell auf Sie abgestimmt
Nachhaltige EntschlossenheitUnsere Strategie ist speziell auf Sie abgestimmt -
 Qualifizierte rechtliche UnterstützungWir bilden uns stetig erstklassig für Sie fort.Dadruch können wir Ihnen zu jederzeit eine rechtlicheBeratung und Vertretung auf höchstem Niveau bieten.
Qualifizierte rechtliche UnterstützungWir bilden uns stetig erstklassig für Sie fort.Dadruch können wir Ihnen zu jederzeit eine rechtlicheBeratung und Vertretung auf höchstem Niveau bieten.
„Ich bitte um Verständnis dafür, das ich ab sofort aus Altergründen neue Mandate nicht mehr annehme“
Wer wir sind & was wir für Sie tun können
Die Wahl des richtigen Rechtsanwalts ist Vertrauenssache - und gleichzeitig entscheidend dafür, um zu Ihrem Recht zu kommen.
Unsere Kanzlei in Fürth spezialisiert sich seit jeher so gut wie ausschließlich auf die Rechtsgebiete Familienrecht und Erbrecht.
Durch diese gezielte Ausrichtung unserer Fachbereiche, erstklassige Qualifikationen und fortlaufende Weiterbildungen, können wir Ihnen stets eine ausgezeichnete Beratung und Vertretung zusichern.
Wir betrachten jeden Fall ganz individuell und setzen uns engagiert und mit professionellem Fingerspitzengefühl für unsere Mandanten ein. Unser Ziel ist es eine gesamtheitliche, kompetente, praxisnahe und vor allem verständliche Beratung anzubieten, mit der wir eine langfristig zufriedenstellende Lösungsstrategie erzielen.
Profitieren Sie von unserer unschlagbaren Kombination aus jahrelanger Erfahrung und junger Dynamik. Wir beraten spezialisiert, kompetent, vertrauensvoll und persönlich.
Gönnen Sie sich die Qualität von Experten!
Familienrecht
Familienrechtliche Veränderungen wie Scheidung, Trennung und Streitigkeiten um Unterhalt, Umgangs- und Sorgerecht stellen die meisten Menschen vor extreme emotionale Herausforderungen.
Mit viel Fingerspitzengefühl und umfassender Fachkompetenz begleiten wir Sie durch familiäre Umbrüche.
Erbrecht
Wir beraten Sie gerne bei der Nachlassplanung, sowie nach dem Erbfall. Insbesondere bei der Erstellung und Prüfung von Testamenten, dem gemeinsamen Ehegattentestament und Erbverträgen.
Eine ausgezeichnete Kanzlei, mit stets individuellen Lösungen
Seit 2004 wurde Herr Rechtsanwalt Lederer vom "FOCUS-Magazin" zu einem der besten 150 Familienrechtsanwälten bundesweit ausgezeichnet.
Im Jahre 2016 gelang es der Kanzlei erneut im Ranking des FOCUS-Magazins aufgenommen zu werden


Ihr herausragender Anwalt

Wolfgang Lederer
Fachanwalt für Familienrecht, Tätigkeitsschwerpunkt auch ErbrechtNach wie vor Fachanwalt mit ganzem Einsatz und viel Freude an der Arbeit.
Wichtiges und Neues für Ihr Recht
Zum Thema Erbrecht
- Nachlasspflegschaft unerlässlich: Wenn der Erbe in einer Gesellschafterversammlung unbekannt ist
- Neuverheiratung unerheblich: Wechselbezügliche Verfügungen zugunsten "unserer Patenkinder" bindend
- OLG reduziert Vergütung: Keine nachträgliche Feststellung einer berufsmäßig ausgeübten Nachlasspflegschaft
- Staatsangehörigkeit entscheidet: Internationale Zuständigkeit deutscher Nachlassgerichte bei Aufenthaltsort Kolumbien
- Streitwert bei Wertermittlungsanspruch: OLG stellt auf realistische wirtschaftliche Erwartungen des Klägers zu Verfahrensbeginn ab
Gesellschafter treffen Entscheidungen auf der Basis eines Gesellschaftsvertrags und abhängig von den dort aufgestellten Regularien. Was aber passiert, wenn ein Gesellschafter verstirbt, der vertretungsberechtigter Geschäftsführer war und dessen Erben unbekannt sind, war Gegenstand einer Entscheidung des Brandenburgischen Oberlandesgerichts (OLG).
Der 2023 verstorbene Erblasser war zusammen mit einer weiteren Person Gesellschafter einer Zweipersonengesellschaft. Zugleich war er als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Nach dem Tod des Erblassers, der keine bekannten Erben hinterließ, beschloss die verbliebene Gesellschafterin, dass sie zur alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführerin bestellt werde. Zugleich beantragte sie die Löschung des Erblassers aus dem Handelsregister. Das Registergericht hat im Wege einer sogenannten Zwischenverfügung angeordnet, dass die Gesellschafterin eine Nachlasspflegschaft beantragen solle und ein Nachlasspfleger zur Versammlung zu laden sei, da Erben unbekannt waren und das Teilnahmerecht an einer Gesellschafterversammlung nicht entzogen werden könne. Gegen diese Entscheidung des Registergerichts legte die Geschäftsführerin Beschwerde ein.
Diese Beschwerde war auch insoweit erfolgreich, als das Registergericht nicht durch eine Zwischenverfügung entscheiden konnte - die Verfügung wurde aufgehoben. Allerdings waren die Mängel in der Beschlussfassung der Gesellschaft erheblich und konnten nachträglich nicht geheilt werden. Aufgrund der unklaren Erbfolge hätte eine Nachlasspflegschaft angeordnet werden müssen. Die Nichtladung eines Gesellschafters stellt einen Einberufungsmangel der Gesellschafterversammlung dar, der zur Nichtigkeit der in der Versammlung gefassten Beschlüsse führt. Die Gesellschaft muss daher zunächst eine Nachlasspflegschaft einrichten lassen und den Nachlasspfleger zur Wahrung der Gesellschafterrechte zu einer weiteren Gesellschafterversammlung einladen.
Hinweis: Bis zur Annahme der Erbschaft hat das Nachlassgericht für eine Sicherung des Nachlasses zu sorgen, soweit hierfür ein Bedarf besteht. Zu diesem Zweck kann ein Nachlasspfleger bestellt werden.
Quelle: Brandenburgisches OLG, Beschl. v. 02.01.2024 - 7 W 66/23
| zum Thema: | Erbrecht |
(aus: Ausgabe 04/2024)
Sind Verfügungen von Ehegatten in einem Testament wechselbezüglich, können sie nach dem Tod des Erstversterbenden grundsätzlich nicht nachträglich abgeändert werden. Das Oberlandesgericht München (OLG) war im Folgenden dennoch mit der Auslegung einer solchen Verfügung betraut, da es sich der Erblasser nach dem Tod seiner ersten Gattin doch noch einmal anders überlegt hatte.
Der Erblasser war seit dem Jahr 2020 in zweiter Ehe verheiratet und hatte keine eigenen Kinder. Der Neffe seiner verstorbenen ersten Ehefrau und die Enkelin seines Bruders - die beide Patenkinder der Eheleute waren - waren einst im gemeinschaftlichen notariellen Testament des Erblassers mit seiner ersten Frau aus dem Jahr 2001 als Schlusserben eingesetzt worden. Nach dem Tod des Längstlebenden sollten sie zu gleichen Teilen erben. Darüber hinaus enthielt das Testament eine Ersatzschlusserbeneinsetzung zugunsten der zu diesem Zeitpunkt lebenden Geschwister der Schlusserben. Später änderte der Erblasser diese Regelung jedoch zugunsten seiner zweiten Ehefrau. Drei handschriftliche Testamente, die von der zweiten Ehefrau geschrieben und vom Verstorbenen unterschrieben wurden, setzten sie offensichtlich als Alleinerbin ein. Als der Neffe gemeinsam mit der Enkelin des Erblassers nach dessen Tod einen Erbschein beantragte, erhob die Witwe des Erblassers dagegen erwartungsgemäß Einwendungen.
Das Nachlassgericht gab dem Antrag des Neffen dennoch statt, da das gemeinschaftliche Testament aus dem Jahr 2001 ihn und das andere Patenkind als Schlusserben festlegte. Das Testament wurde so ausgelegt, dass die erbrechtlichen Verfügungen wechselbezüglich und bindend waren. Die Änderung zugunsten der zweiten Ehefrau wurde als unwirksam erklärt. Die weiteren handschriftlichen Testamente wurden als nicht formwirksam erachtet, da sie nicht den rechtlichen Anforderungen entsprachen.
Dieser Einschätzung schloss sich schließlich auch das OLG an. Auch wenn das notarielle Testament keine ausdrückliche wechselbezügliche Regelung enthielt, kam das Gericht über eine Auslegung dazu, dass die Schlusserbeneinsetzung der Patenkinder wechselbezüglich getroffen wurde - und damit auch für den Längstlebenden bindend war. Für das OLG spielte hier eine Rolle, dass die Erblasser in dem Testament formulierten, dass "unsere" Patenkinder als Schlusserben eingesetzt werden. Die Einsetzung erfolgte daher aufgrund eines gemeinsamen Willens beider Eheleute - unabhängig von den familiären Beziehungen. Hierfür sprach nach Ansicht des Gerichts auch, dass als Ersatzschlusserben die Geschwister der Patenkinder benannt wurden, was nochmals verdeutlichte, dass es den Erblassern nicht darauf ankam, nur die jeweiligen Familienstämme zu bedenken. Den eingesetzten Erben wurde der beantragte gemeinschaftliche Erbschein erteilt.
Hinweis: Im Zweifel gilt, dass Verfügungen von Eheleuten dann wechselbezüglich sind, wenn die Ehegatten sich gegenseitig bedenken oder wenn dem einen Ehegatten von dem anderen eine Zuwendung gemacht und für den Fall des Überlebens des Bedachten eine Verfügung zugunsten einer Person getroffen wird, die mit dem anderen Ehegatten verwandt ist oder ihm sonst nahe steht.
Quelle: OLG München, Beschl. v. 30.01.2024 - 33 Wx 191/23 e
| zum Thema: | Erbrecht |
(aus: Ausgabe 04/2024)
Das Nachlassgericht kann zur Sicherung und Verwaltung eines Nachlasses sowie zur Ermittlung von Erben einen Nachlasspfleger bestellen, der für seine Tätigkeit eine Vergütung erhält. Deren Höhe kann sich erheblich unterscheiden - je nachdem, ob der Nachlasspfleger diese Tätigkeit berufsmäßig ausübt oder eben nicht. Da hier eine solche Prüfung vorab unterblieben ist, musste sich das Oberlandesgericht München (OLG) mit den Folgen der ausgebliebenen Differenzierung befassen.
Die Erblasserin verstarb im Jahr 2006, und das Nachlassgericht ernannte einen Nachlasspfleger zum Zweck der Sicherung und Verwaltung des Nachlasses sowie zur Erbenermittlung. Die Feststellung einer berufsmäßigen Führung der Nachlasspflegschaft wurde nicht vorgenommen. Der Nachlasspfleger beantragte im März 2022 eine Vergütung von 14.979 EUR für seine Tätigkeit, die das Nachlassgericht im April 2023 auch genehmigte. Hiergegen legten die Erben Beschwerde ein. Ihre Begründung: Weder Prüffähigkeit der Abrechnung noch Plausibilität einiger Tätigkeiten könnten nachvollzogen werden. Das Nachlassgericht wies die Beschwerde ab und legte die Akten zur Entscheidung dem OLG vor.
Der Senat hat entschieden, dass die Festsetzung der Vergütung des Nachlasspflegers als berufsmäßiger Nachlasspfleger nicht möglich sei, da eine solche Feststellung im Bestellungsverfahren unterblieben ist. Daher kann die Vergütung nur anhand des Umfangs, der Schwierigkeiten sowie des angefallenen Zeitaufwands bemessen werden. Es wurde festgestellt, dass der Umfang und die Schwierigkeit der Tätigkeiten des Nachlasspflegers eine angemessene Vergütung rechtfertigen; die Höhe der Vergütung wurde auf 4.579 EUR festgelegt, basierend auf den vom Nachlasspfleger vorgelegten Stunden und einem aus Sicht des Gerichts angemessenen Stundensatz.
Hinweis: Als Anhaltspunkte für die Bemessung eines Stundensatzes können die Fälle des § 3 Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz herangezogen werden.
Quelle: OLG München, Beschl. v. 30.01.2024 - 33 Wx 152/23 e
| zum Thema: | Erbrecht |
(aus: Ausgabe 04/2024)
Verstirbt ein deutscher Staatsbürger im Ausland, stellt sich zur Regelung der Nachlassangelegenheiten meist die Frage, in welchem Land die Zuständigkeit des Nachlassgerichts gegeben ist. Der folgende Fall des Oberlandesgerichts Karlsruhe (OLG) wies hierbei einige interessante Besonderheiten auf.
Der Erblasser war deutscher Staatsangehöriger und im Jahr 2019 an seinem letzten Wohnort in Kolumbien verstorben. Sein Nachlass umfasste unter anderem Immobilien in Schweden und Kolumbien, GmbH-Anteile einer Firma in Deutschland sowie Guthaben und Bankkonten in Deutschland und der Schweiz. Der Mann war insgesamt viermal verheiratet, wobei aus der ersten Ehe zwei leibliche Kinder hervorgegangen waren. Seit 2011 war der Erblasser zudem auch als Staatsbürger in Schweden registriert, seit dem Jahr 2016 war sein gewöhnlicher Aufenthalt in Kolumbien. Aufgrund eines privatschriftlichen Testaments aus dem Jahr 2002 ging es in dem Erbscheinsverfahren unter anderem um die internationale und örtliche Zuständigkeit des Amtsgerichts Konstanz (AG).
Das OLG bestätigte insoweit die Einschätzung des AG, dass dieses für die Erteilung des Erbscheins sowohl international als auch örtlich zuständig war. Zunächst prüfte das Gericht, wo der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes den gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und kam zu dem Ergebnis, dass es sich hierbei um Kolumbien handelte. Nach dieser Feststellung sind die Gerichte eines Mitgliedstaats, in dem sich Nachlassvermögen befindet, für Entscheidungen in Erbsachen für den gesamten Nachlass zuständig - aber nur, sofern der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes die Staatsangehörigkeit dieses Mitgliedstaates besaß. Dabei ist unerheblich, ob es sich um das gesamte Vermögen des Erblassers handelt oder welchen Anteil am Gesamtvermögen dieses ausmacht. Also kam es einzig auf die Staatsangehörigkeit des Erblassers an. Örtlich war das AG zuständig, weil der Erblasser zu einem früheren Zeitpunkt dort einmal seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Unerheblich blieb, wie lange der letzte gewöhnliche Aufenthalt bereits zurücklag. Da das Gericht auch zu dem Prüfungsergebnis kam, dass das Testament formal wirksam war, durfte das Nachlassgericht auch den entsprechenden Erbschein erteilen.
Hinweis: Auch die Frage der Testierfähigkeit beurteilte sich in dem Fall nach deutschem Erbrecht.
Quelle: OLG Karlsruhe, Beschl. v. 19.02.2024 - 14 W 87/23
| zum Thema: | Erbrecht |
(aus: Ausgabe 04/2024)
Die Kosten einer möglichen Rechtsverfolgung spielen eine beachtliche Rolle. Dazu gehören insbesondere Anwaltskosten, die häufig anhand des Streitwerts bemessen werden. Genau um einen solchen Streitwert ging es auch im folgenden Rechtsstreit, den das Oberlandesgericht München (OLG) zu bewerten hatte.
Die pflichtteilsberechtigte Klägerin forderte den beklagten Erben auf, den Wert des von der Erblasserin hinterlassenen Schmucks durch Vorlage eines Gutachtens festzustellen. Sie bezifferte den Wert des Schmucks in ihrer Klageschrift auf 5.000.000 EUR und ermittelte darauf basierend einen Streitwert von 312.500 EUR, den das zuerst betraute Landgericht (LG) zunächst auch zugrunde legte. Der Beklagte legte dagegen eine Beschwerde ein - er vertrat die Ansicht, der Wert sei lediglich auf 37.500 EUR oder hilfsweise auf 93.750 EUR festzusetzen. Das LG wies diese Beschwerde zurück und legte die Akten zur Entscheidung dem OLG vor.
Das OLG stimmte dem Ansatz des LG grundsätzlich zu, den Streitwert auf der Grundlage der von der Klägerin angegebenen Werte festzusetzen. Da der Anspruch auf Wertermittlung ein Hilfsanspruch für die Bemessung des späteren Zahlungsanspruchs ist, wurde ein deutlicher Abschlag vorgenommen. Unter Berücksichtigung der Grundsätze des Bundesgerichtshofs wurde eine Quote von 10 % des Leistungsanspruchs zugrunde gelegt, was ausgehend von einem Pflichtteilsanspruch von 695.500 EUR zu einem Streitwert von 62.500 EUR führte.
Hinweis: Kommt es im Rahmen einer sogenannten Stufenklage nach Erteilung der Auskunft auf der ersten Stufe nicht mehr zu einer Bezifferung eines Leistungsanspruchs auf der nächsten Stufe (sogenannte steckengebliebene Stufenklage), stellen Gerichte hinsichtlich des Streitwerts auf die realistischen wirtschaftlichen Erwartungen eines Klägers zu Beginn des Verfahrens ab. Diese Betrachtung hat das OLG auch in dem entschiedenen Fall herangezogen.
Quelle: OLG München, Beschl. v. 19.02.2024 - 33 Wx 71/24 e
| zum Thema: | Erbrecht |
(aus: Ausgabe 04/2024)
Zum Thema Familienrecht
- Freier Wille: Persönliche Ablehnung eines geeigneten Betreuers muss respektiert werden
- Keine Härtefallscheidung: Außereheliche Schwangerschaft ist keine unzumutbare Härte für die Schwangere selbst
- Nachweis akuter Gefahr: Keine zweijährige Zwangsbehandlung von psychisch Kranker ohne konkreten Gefährdungsgrad
- Nicht leibliches Kind: Nach Trennung ist sozialer Vater im Umgang nicht rechtlos
- Unveräußerbares Kindeswohl: Regelung zu Vertragsstrafe in Umgangsvereinbarung ist unwirksam
Wer seine Angelegenheiten nicht (mehr) selbst besorgen kann, weil er dement oder geistig oder psychisch eingeschränkt ist, bekommt einen gerichtlichen Betreuer beigeordnet, wenn er niemanden aus der Familie bevollmächtigt hat. Der Bundesgerichtshof (BGH) musste entscheiden, ob der Wille der Betroffenen oder eine objektive Betrachtung der Situation Antwort auf die Frage geben soll, ob und inwieweit die Befugnisse eines Berufsbetreuers erweitert werden.
Eine knapp 40-jährige Frau hatte schon Jahrzehnte eine solche Betreuung, weil sie unter dem Asperger-Syndrom litt. Der Berufsbetreuer, der sich bislang nur um ihre Post und ihr Geld zu kümmern hatte, wollte nun auch die Gesundheitsfürsorge übernehmen, nachdem die Frau einen Konflikt mit ihrer Krankenkasse nicht selbst lösen konnte und deshalb ein Verfahren am Sozialgericht lief. Die Betreute wollte aber in diesem Bereich lieber durch ihre Mutter vertreten werden.
Gegen den freien Willen eines Volljährigen darf kein Betreuer bestellt werden (§ 1814 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch). Das umfasst - so der BGH - nicht nur die Betreuung als solche, sondern auch die Betreuungsperson. Wenn eine Betroffene ausdrücklich eine Betreuungsperson wünscht und das ihr "freier Wille" ist, muss das Gericht dies berücksichtigen. Für einen "freien Willen" bedarf es dabei nicht einmal der Geschäftsfähigkeit. Die beiden entscheidenden Kriterien hierfür sind zum einen die Einsichtsfähigkeit des Betroffenen und zum anderen dessen Fähigkeit, nach dieser Einsicht zu handeln und sich dabei von den Einflüssen interessierter Dritter abzugrenzen. Das Gericht darf dann auch nicht prüfen, ob es objektiv vorteilhafter wäre, dass ein Berufsbetreuer sich kümmert, weil er es besser kann - der "freie Wille" ist höherrangig gegenüber objektiven Vorteilen. Deshalb war es nun hier an einem Gutachter, zu prüfen, ob die Mutter als Betreuerin für die Gesundheitsfürsorge zu bestellen ist.
Hinweis: Gründe, den vom Betreuten mit freiem Willen benannten Betreuer nicht zu bestellen, gibt es nur zwei: Der Betreuer selbst lehnt ab oder er ist objektiv ungeeignet für die Aufgabe.
Quelle: BGH, Beschl. v. 10.01.2024 - XII ZB 217/23
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 04/2024)
Ist eine Verheiratete schwanger, und zwar nicht vom Ehegatten, kann dies durchaus einen Grund für eine sogenannte Härtescheidung sein. Im folgenden Fall war dies der Grund für eine Schwangere, um für sich Verfahrenskostenhilfe (VKH) für die Stellung eines Scheidungsantrags zu beantragen. Das Oberlandesgericht Zweibrücken (OLG) jedoch lehnte ab. Lesen Sie hier, warum.
Die einzige Möglichkeit, ohne Trennungsjahr unverzüglich geschieden zu werden, ist eine Unzumutbarkeit der weiteren Eheführung. Früher wurde eine solche Unzumutbarkeit in einer Schwangerschaft der Ehefrau von einem anderen Mann gesehen - die letzten positiven obergerichtlichen Entscheidungen dazu sind aber auch schon über 20 Jahre alt (z.B. OLG Karlsruhe, Beschluss vom 13.04.2000 - 20 WF 32/00). Auch heutzutage kann ein solcher Umstand Ausschlag dafür geben, das Trennungsjahr auszusparen und früher geschieden zu werden. Die Antragstellerin war hier nicht nur von einem anderen Mann schwanger, sondern trug vor, zudem an Depressionen zu leiden, die ein weiteres Zusammenleben unzumutbar machten. Dennoch lehnte das Familiengericht die VKH ab - es sah schlichtweg keine Aussichten auf Erfolg.
Das OLG schloss sich dieser Auffassung an. Sowohl eine außereheliche Schwangerschaft als auch eine Depressionserkrankung können zwar durchaus Härtefälle darstellen. Auf keinen Fall kann sich aber die Ehefrau selbst darauf berufen, wenn sie den Antrag auf Scheidung vor Ablauf des Trennungsjahres stellt. Denn weder die vorgetragene Depressionserkrankung der Antragstellerin noch die Schwangerschaft seien in der Person des Antragsgegners begründet. Und diese Begründung ist für die Härtefallregelung unverzichtbar. So verweigerte auch das OLG der schwangeren Frau die VKH.
Hinweis: Die Fortsetzung der Ehe muss für den Antragsteller selbst eine unzumutbare Härte darstellen, die in der Person des anderen Ehegatten begründet sind. Das soll verhindern, dass sich der Antragsteller auf eigene gravierende Unzulänglichkeiten berufen kann. Ebenfalls nicht unzumutbar ist ein Abwarten des Trennungsjahres, wenn alle Härten des Zusammenlebens allein schon durch eine räumliche Trennung beendet werden können (beispielsweise bei häuslicher Gewalt).
Quelle: OLG Zweibrücken, Beschl. v. 07.02.2024 - 2 WF 26/24
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 04/2024)
Wer psychisch schwer erkrankt ist und deshalb unter gerichtlicher Betreuung steht, ist naturgemäß nicht immer einsichtig - auch was die notwendige Medikamentierung angeht. Welche Möglichkeiten den Betreuern in derartigen Lagen offenstehen und was vor allem dafür an gerichtlicher Vorarbeit zu leisten ist, zeigt das folgende Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH).
Eine 50-Jährige war bereits viele Jahre paranoid und psychotisch. Ihr Medikament schlug nicht mehr an, ein anderes Medikament wollte sie nicht ausprobieren. Deshalb beantragte die Betreuerin eine gerichtliche Genehmigung zur Zwangsbehandlung in einer Klinik, verbunden mit Zwangsunterbringung für zwei Jahre, weil die Dosierung längerfristig erprobt und eingestellt werden müsse. Außerdem bestehe die Hoffnung, dass die Betreute nach einer so langen Behandlung einsichtig genug geworden sei, anschließend ihre Medikamente freiwillig einzunehmen.
Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Zwangsbehandlung psychisch Kranker sind sehr hoch, das ist als Folge ärztlichen Verhaltens im Nationalsozialismus zu verstehen. Allein die Tatsache, dass es vernünftig wäre, eine Langzeittherapie mit einem neuen Medikament zu beginnen, genügt dafür nicht. Auch der psychisch Kranke verdient Respekt vor seinem Willen, solange keine akute, ernstliche und konkrete Gefahr für Leib und Leben des Betreuten vorliegt. Die Hinweise in der Akte darauf, dass die Betroffene durch ihr Wahnerleben so stark beeinträchtigt sei, dass "sie sich nicht mehr ausreichend selbst versorgen (...), keinerlei Gefahren abschätzen (...) und Dritte bedrohen" könne, genügten dem BGH dafür nicht. Erforderlich wären nähere Feststellungen zur konkreten Art der befürchteten selbstschädigenden Handlungen und der durch sie möglicherweise eintretenden erheblichen Gesundheitsschäden. So gab der BGH die Akte an das Landgericht zurück, um die Antworten zum konkreten Gefährdungsgrad zu ermitteln.
Hinweis: Die Entscheidung zeigt das Grundrecht des Menschen zu selbstschädigendem Verhalten auf.
Quelle: BGH, Urt. v. 17.01.2024 - XII ZB 434/23
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 04/2024)
Im folgenden Fall musste das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) nach dem Amtsgericht Bensberg (AG) über den Umgang mit einem Fünfjährigen entscheiden, dessen Eltern sich noch vor seiner Geburt getrennt hatten. Der Mann, mit dem die Mutter danach zusammenlebte und von dem sie sich nach gut vier Jahren kurz nach der Geburt eines gemeinsamen Kindes wieder trennte, wünschte sich aber weiterhin Kontakt mit dem Fünfjährigen.
Die Mutter, die wieder mit dem Vater des Fünfjährigen zusammenlebte, verweigerte dem Expartner den Umgang mit seinem einstigen Ziehsohn. Doch auch enge Bezugspersonen können ein Recht auf Umgang mit dem Kind haben (§ 1685 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch), wenn sie für dieses Kind die tatsächliche Verantwortung tragen bzw. getragen haben und der Umgang dem Wohl des betroffenen Kindes dient. Das AG stellte daher fest, dass der Antragsteller eine ähnlich wichtige Bezugsperson für das Kind wie die leiblichen Eltern sei, da er mit dem Kind über mehrere Jahre in häuslicher Gemeinschaft gelebt und der Junge ihn von Beginn an als "Papa" angesehen habe. Der Bindungsabbruch aufgrund der ablehnenden Haltung der Eltern habe ein solches Maß erreicht, dass sich hieraus eine Gefahr für die Entwicklung des Kindes ergeben könne. Deshalb bestellte das Gericht einen Umgangspfleger, der durchzusetzen habe, dass der Junge in den ungeraden Kalenderwochen von Freitag 15 Uhr bis Montag 9 Uhr und jede Woche dienstags von 15 Uhr bis mittwochs 9 Uhr bei diesem Mann verbringe. Auf die Anhörung des Kindes verzichtete das AG, um den Loyalitätskonflikt nicht zu vertiefen, nachdem die Eltern zum Anhörungstermin des Kindes eine Krankmeldung eingereicht hatten. Die Eltern legten Beschwerde ein und verweigerten in der Zwischenzeit auch die Zusammenarbeit mit der Umgangspflegerin.
Das OLG hob die Entscheidung auf, weil sie nicht ohne die Anhörung des Kindes hätte ergehen dürfen. Das AG hätte sich selbst ein Bild von dem betroffenen Kind machen und notfalls erzwingen müssen, dass die Eltern es dafür zum Gericht bringen - notfalls mit Zwangsgeld oder Zwangshaft. Für das erneute Verfahren beim AG gab das OLG zu bedenken, dass die Umgangsregelung zu großzügig sein könnte, weil sie sich am Üblichen für leibliche Eltern orientierte. Üblich seien stattdessen eher Tagesbesuche. Insbesondere sei zu berücksichtigen, dass zwischen den drei Erwachsenen erhebliche Spannungen herrschen und die Kindeseltern sich vehement gegen einen Umgang ausgesprochen hatten. Es sei daher nur schwer vorstellbar, wie innerhalb eines großzügigen Umgangsrechts erzieherische und organisatorische Absprachen ablaufen sollten.
Hinweis: Anders als der leibliche Vater hat eine "sonstige Bezugsperson" auch während des Umgangs keinerlei Entscheidungsbefugnisse.
Quelle: OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 18.01.2024 - 6 UF 224/23
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 04/2024)
Im folgenden Streitfall lag das Familiengericht mit der Regelung außerhalb Europas zum Umgang der Kinder mit ihrem Vater und dessen Zugewinnleistung für die mit den Kindern lebende Mutter nicht gänzlich falsch. Was die nach Gegenwehr der Mutter damit befassten Instanzen - Amtsgericht (AG) und Oberlandesgericht (OLG) - nicht bemängelten, machte der Sache aber vor dem Bundesgerichtshof (BGH) einen Strich durch die Rechnung.
Es standen sich die Zugewinnforderung einer Ehefrau und der Umgangswunsch des Ehemanns mit seinen Kindern gegenüber. Die Kinder lebten mit der Mutter in Peru. Weil sein Umgangsrecht dort schwer durchzusetzen war, machte der Vater die Zahlung des Zugewinnausgleichs in Raten davon abhängig, dass die Umgangsvereinbarung auch tatsächlich klappte: Die jährliche Rate von 20.000 EUR sollte in den nächsten drei Jahren jeweils erst dann fällig werden, nachdem die gemeinsamen Kinder drei Wochen Sommerumgang mit dem Vater in Deutschland gehabt haben. Die Mutter stimmte zu, das Familiengericht protokollierte dies als Vereinbarung und billigte diese im Hinblick auf das Kindeswohl, ohne die Kinder angehört oder das Jugendamt beteiligt zu haben. Dann klagte die Frau auf Unwirksamkeit der Vereinbarung. Weder wollte sie den Vergleich zum Zugewinn akzeptieren noch ein Ordnungsgeld für den Fall riskieren, dass sie den Umgang mit den Kindern vereitelt. AG und OLG gaben ihr nicht recht - doch was sagte der BGH?
Der BGH verwies darauf, dass eine Verknüpfung von Geld und Umgang immer kritisch zu betrachten sei. Kinder dürfen nicht zum Gegenstand eines Handels werden, ihr Wohl darf nicht verkauft werden. Das ist sittenwidrig und wird als unzulässige Kommerzialisierung des Elternrechts beurteilt. Die Gerichte hatten hier zwar keine Zweifel daran, dass der Vater ohnehin ein Recht auf dreiwöchigen Sommerurlaub mit den Kindern habe, und verstanden, dass es ihm nur darum ging, die Lästigkeiten oder Unmöglichkeiten einer Vollstreckung im außereuropäischen Ausland zu beseitigen. Die Vereinbarung hatte daher den Charakter einer Vertragsstrafe. Das wäre bei einem solchen Auslandsfall prinzipiell zwar möglich, weil die Motive nicht kindeswohlwidrig sind. Dennoch sah es der BGH als Problem, dass es kein Umgangsverfahren gegeben hatte, in dem das Kindeswohl geprüft, die Kinder angehört und das Jugendamt beteiligt worden wären. Zudem merkte der BGH an, dass sich das Kindeswohl in den nächsten Jahren ändern und es somit künftig auch gute Gründe geben könne, aus denen der Umgang mit dem Vater in Deutschland nicht stattfinde. Es fehlte eine Regelung dazu, was dann mit dem Zahlungsanspruch der Mutter geschehen solle. Daher kam der BGH nicht umhin, der Mutter recht zu geben und den Vergleich als insgesamt nichtig zu erklären.
Hinweis: Die Entscheidung des BGH führte dazu, dass auch über den Zugewinn neu verhandelt werden musste.
Quelle: BGH, Urt. v. 31.01.2024 - XII ZB 385/23
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 04/2024)
Was sagen unsere Mandanten
Ich wurde ich hier wie ein VIP vom Herr Kravack und der ganzen Kanzlei behandelt.
Her Kravack setzte sich sofort ein und verfasste auf eine Klage des Antragsgegners auf 11 Seiten seine Antwort. Er hat sich sehr viel Zeit genommen um mich anzuhören und mit klugen Fragen auch das rauszuholen um meine Interessen fachlich zu vertreten.
Er war stets besorgt mich richtig zu beraten und mich auf den laufenden zu halten. Er ist sehr engagiert und kennt sich in seinem gebiet sehr gut aus.
Außerdem sprechen wir hier über einen empatischen und sympatischen Menschen der Ihnen das Gefühl von Sicherheit und bestmöglicher juristischer Unterstützung gibt.
Daher kann ich jedem diese Kanzlei wärmstens empfehlen!

Herr Lederer,
ich finde Ihre Arbeit sehr gut und kann dem einen Beitrag in keinster Weise zustimmen. Ich habe mich immer gut behandelt und auch ernstgenommen gefühlt. Ich habe warhscheinlich selbst mehr Arbeit gemacht als ich eingebracht habe und es war weder Anlass für Sie noch Ihre Mitarbeiter mich deshalb schlechter zu behandeln.
Auch der Ausgang des Verfahrens war zu meiner Zufriedenheit. Vielen Dank

Als Dauermandantin mit meinem Betrieb werde ich stets mit vollstem Engagement von den beiden Anwälten vertreten.Selbst in äußerst schwierigen rechtlichen Fällen wird mir kompetent und immer zuvorkommend geholfen.Das letzte Beispiel hierfür war ein Verfahren in Hamburg, das durch den Einsatz der Kanzlei mit einem 5-stelligen Betrag zu meinen Gunsten entschieden wurde.

Herr FA Lederer hat meine Scheidung im Jahr 2014 vorgenommen und dabei sehr pflichtbewusst meine Interessen vertreten und sich die Zeit genommen, die es braucht, um sich als Mandant gewertschätzt fühlen zu können

only can tell what a friend of mine told me about this lawyer. very good service and the one star is only missing because the office is so hard to find.
my friend has no facebook. greets

Sehr gute anwaltliche Beratung auf höchstem Niveau. Vielen Dank, Herr Lederer

Ich bin sehr zufrieden. Sehr gute und kompetente Beratung und Vertretung vor Gericht. Ein positives Ergebnis erreicht. Immer schnelle Rückmeldungen per Email oder Telefon. Würde ich immer weiterempfehlen!

Sehr kompetenter und freundlicher Anwalt, der sich die Zeit nimmt, alles gewissenhaft zu erledigen. Top Dienstleistung